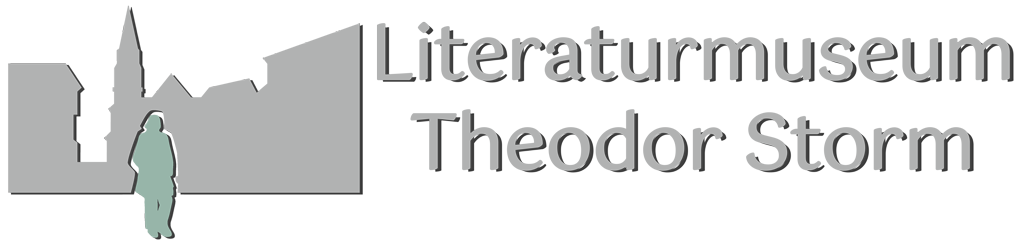Pole Poppenspäler – Sozialkritisches Plädoyer für die Kunst des Puppenspiels (1/2)
Heute ist der sogenannte „Internationale Tag des Puppenspiels“. Im Jahr 2002 rief die „Union Internationale de la Marionette“, kurz „UNIMA“, diesen Tag auf Anregung des iranischen Puppenkünstlers Javad Zolfaghari ins Leben. Der Zweck bestand und besteht noch heute darin, das in der Gesellschaft oftmals wenig wertgeschätzte Puppentheater gezielter ins Zentrum der globalen Aufmerksamkeit zu rücken. Seine handwerkliche sowie theatralische Kunst wird am heutigen Tag deswegen mit weltweiten Veranstaltungen gewürdigt.
Wie Theodor Storm zu seinen Lebzeiten interessieren auch wir – das Literaturmuseum „Theodor Storm“- uns in einem besonderen Maße für die Puppenspielkunst.
Das zeigt sich zum Beispiel anhand unserer Dauerausstellung. In unserem Puppenflur ist immer eine Auswahl unseres umfangreichen Sammlungsbestandes zum Heiligenstädter Puppenspieler Ignaz Tschich ausgestellt. Außerdem ist bei uns auch ein besonderes Herzstück der Puppenspielkunst, das mechanische Puppentheater zur „Regentrude“, zu sehen. Es wurde von dem Erfurter Puppenbauer und Mechanikus Martin Gobsch samt seines Teams geschaffen. Vor Kurzem haben wir in dem Raum, der dem Puppentheater zur „Regentrude“ gewidmet ist, einen neuen Ausstellungstext mit vielen interessanten Informationen angebracht. Bei uns gibt es immer wieder Neues zu entdecken, kommen Sie uns daher gerne besuchen!
Theodor Storm verfasste sogar eine Novelle über die Puppenspielkunst. Gemeint ist hierbei natürlich der „Pole Poppenspäler“.
Zum Anlass des heutigen „Internationalen Tag des Puppenspiels“ beschäftigt sich der literarische Blogbeitrag März im Folgenden mit eben jener Novelle. Als seine erste Auftragsarbeit überhaupt schrieb Storm sie für die Zeitschrift „Deutsche Jugend“ im Jahr 1873 nieder. Abgesehen von der komplexen sowie zwiespältigen Symbolkraft des Kasperls in seiner Funktion als tonangebende „lustige Person“ im Puppentheater verdeutlicht der Prosa-Text den unkonventionellen Lebenswandel „landfahrender Leute“. Dieser macht(e) sie gleichsam zu Außenseitern, wenn nicht gar zu systematisch Geächteten der Gesellschaft.
Im ersten Part dieses zweiteiligen Blogbeitrags wird eine Zusammenfassung des Novellen-Inhalts und eine historische Einordnung der Puppenspielkunst und ihrer Kunstschaffenden gegeben. Darauffolgend wird im zweiten Teil aufzuzeigen sein, wie das Puppenspiel aus künstlerischer, sozialer und gesellschaftlicher Perspektive in Theodor Storm Novelle gespiegelt wird.
Die Rahmenhandlung setzt ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts bei einem Jungen in einer nicht benannten Stadt in Schleswig-Holstein ein (die allerdings aufgrund von Standortbe-schreibungen und einem explizit genannten Straßennamen – die Süderstraße – als Husum identifiziert werden kann). Aufgrund seiner natürlichen Begabung für Drechselarbeiten und auf die Bitte seines Vaters hin macht er die Bekanntschaft mit dem stadtansässigen Kunstdrechsler und Mechanikus, Paul Paulsen, sowie dessen Ehefrau. Nachdem sich innerhalb eines Jahres ein Vertrauensverhältnis entwickelt hat, erfährt der Junge zufällig von dem Beinamen „Pole Poppenspäler „. Mit diesem wird Paulsen in der Stadt immer wieder in Verbindung gebracht.
Aus unbedarfter Neugier fragt der Junge den Betroffenen danach, woraufhin sich eine Binnenerzählung entspinnt. Diese ist zweigeteilt und erstreckt sich über eine Zeitspanne von mehreren Jahrzehnten. So berichtet Paulsen im ersten Teil, wie eines Tages in seiner Kindheit die Tendlers – eine kunstschaffende Puppenspielfamilie aus Süddeutschland – in die Stadt gekommen sei. Nicht nur macht Paulsen die schicksalhafte Bekanntschaft mit deren Tochter Lisei, sondern beginnt selbst sich für die Puppenspielkunst zu interessieren. Nach einigen Monaten ziehen die Tendlers weiter. Paulsen bleibt ohne Lisei bei seinen Eltern zurück.
Als der zweite Teil der Binnenerzählung beginnt, sind zwölf Jahre seit dem Abschied von den Tendlers vergangen: Paulsen – nun ein junger Mann – verbringt seine Gesellenjahre nach dem Tod seiner Eltern sowie der dreijährigen Wanderschaft in einer mitteldeutschen Stadt in dem Dienst der Witwe eines Handwerkmeisters. Eines Sonntagnachmittags trifft er erneut auf Lisei. Er erfährt, dass Vater Joseph Tendler zu Unrecht eines Diebstahls beschuldigt ins Gefängnis gesperrt worden ist und vor Gericht gestellt werden soll.
Durch Paulsens Hilfe kann sich die Situation zum Guten für Vater Tendler wenden, sodass er freigelassen wird. Kurz darauf willigt dieser in die Heirat zwischen Lisei und Paulsen ein. Zurück in die Geburtsstadt Paulsens gezogen und sesshaft geworden, leben alle drei zunächst in familiärer Eintracht zusammen. Allerdings kann sich Joseph Tendler nicht von seiner Puppenspiel-Kunst lösen. Es zeigt sich, dass auch die Husumer Stadtbevölkerung alles andere als tolerant dem Puppenspieler gegenüber eingestellt ist…
Obwohl durch die nachhaltig wirkungsmächtige Dialektik der Aufklärungsbewegung seit dem 18. Jahrhundert das Theater zunehmend für die allgemeine Bevölkerung unabhängig des gesellschaftlichen Standes geöffnet wurde, begann man daraufhin eine noch drastischere Trennung zwischen „niederer“ und „höherer“ Kunst vorzunehmen. Zunächst theoretisch formuliert, dann in der Lebenswelt praktisch realisiert, galten Lachen und Vergnügen um ihrer selbst willen fortan als trivial und somit als minderwertig. Diversen Stimmen in der Aufklärungsbewegung zufolge fehle ihnen die von ihnen geforderte Ernsthaftigkeit in der angestrebten Bildungsvermittlung und moralischen Erziehung des Publikums.
Das wiederum hatte zur Konsequenz, dass dem Puppenspiel in jeglicher Spielart trotz seiner allgemeinen Beliebtheit die künstlerische Eigenwertigkeit abgesprochen wurde: Auch sie zählte zu den niederen Vergnügungsformen der Massen. Nicht unerheblich wirkte sich diese Bewertung auch auf die gesellschaftliche Wahrnehmung und den Lebensalltag der Kunstschaffenden des Puppenspiels selbst aus.
Um die Mitte des 18. Jahrhunderts war es in Deutschland noch typisch, dass ortsansässige Handwerker lokal und regional wandernde Puppentheater-Truppen anleiteten. Das veränderte sich zunehmend ab dem 19. Jahrhundert. Nun begannen sich kleinere Truppen vor allem in familiären Verbänden aus kurzfristig oder längerfristig mittellosen Menschen zu bilden. Oftmals handelte es sich dabei um Bäcker oder Schneider, die wegen Preisteuerungen ihren Betrieb nicht weiterführen konnten. Genauso betroffen waren auch Bergleute, die in Wintermonaten arbeitslos geworden waren oder Soldaten, die zum Beispiel aufgrund von Krankheit aus ihrem Dienst entlassen worden waren und keine andere bzw. festangestellte Arbeit mehr finden konnten.
Vor allem kinderreiche Familien aus den genannten Milieus betätigten sich aus Not dem Puppenspiel. Sie wurden zum Bestandteil des „fahrenden Volks“. Ständig umherwandernd und ohne festen Wohnsitz mussten sie „von der Hand in den Mund“ leben. Wenn der tägliche Verdienst der Auftritte überhaupt genügte, um sich den nötigsten Lebensbedarf leisten zu können, bestand für gewöhnlich keine Möglichkeit finanzielle Rücklagen für Alter und Krankheit zu bilden. Zudem waren die Puppenspiel-Familien den Rahmenbedingungen für ihre Arbeit völlig ausgeliefert: Wären sie in der Lage einen geeigneten Platz zum Proben, Aufführen und Schlafen zu finden? Würde ein zahlenmäßig ausreichendes Publikum für den nächsten Auftritt zusammenkommen, um genügend Geld einzunehmen?
Vielerorts waren sie und andere Kunstschaffende im Schaustellergewerbe nicht erwünscht. Wegen ihrer nicht mit bürgerlichen Normen zu vereinbarenden Lebensweise galten sie als gesellschaftlich Ausgestoßene. Dementsprechend wurden sie behandelt. Die strengen Vorschriften und Auflagen, die ihnen die Polizeibehörden auferlegten, erschwerten noch dazu die Einnahmesituation und begünstigen gleichermaßen ihre Kriminalisierung. Oftmals entstanden auch zwischen Kunstschaffende aufgrund der schwierigen Arbeitsbedingungen vor Ort Rivalitäten, z. B. zwischen Puppenspiel-Familien sowie Hofschauspielenden.
Fortsetzung folgt.