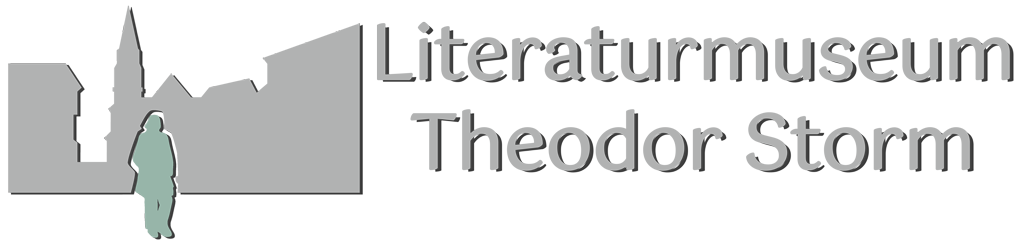Die 32. Stormtage in Heiligenstadt – Ein Rückblick mit zwei besonderen Schenkungen für den Sammlungsbestand des Literaturmuseums (2/2)
Samstagnachmittag und Samstagabend
Dr. Frank Pritzke: Heines Taufe in Heiligenstadt. Theologische und biographische Aspekte
Nach der Mittagspause fanden sich alle wieder im Rosengarten des Literaturmuseums für den dritten Vortrag zusammen. Der Referent Dr. Frank Pritzke, der als Pastor und seit 2015 an der Theologischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen auch als Lektor für Latein tätig ist, legte seine Auseinandersetzung mit Heinrich Heines Taufe in Heiligenstadt unter biographischen und theologischen Aspekten dar. Auf Basis der wissenschaftlichen Beschäftigung und der daran anschließenden Fragestellungen von Ferdinand Schlingensiepen rekonstruierte Dr. Pritzke die Tauf-Begebenheiten und stellte die Quellenlage zur Einordnung dieses Ereignisses vor. Zweitere setzte sich vornehmlich aus dem im Pfarrarchiv der Heiligenstädter St. Martinskirche aufbewahrten Briefkontakt zwischen Heine und dem damals amtierenden evangelischen Pfarrer, Gottlob Christian Grimm, zusammen. Heine selbst hinterließ der Nachwelt keine konkreten oder offiziellen Zeugnisse über seine Taufe.
Außerdem verwies Dr. Pritzke auf den spannenden Umstand, dass Theodor Storms Töchter, Elsabe und Lucie, mit derselben Taufschale wie Heinrich Heine getauft wurden. Storm selbst jedoch war nicht bekannt, dass sein großes Dichter-Idol auf diese Weise den Weg mit ihm in Heiligenstadt gekreuzt hatte.
Pause im Rosengarten und Auftritt der Künstlergruppe Christian Georgie und Detlev Rose: „Ich bin ein deutscher Dichter“. Reminiszenzen an Heinrich Heine.
Ergänzt wurde die künstlerische sowie wissenschaftliche Beschäftigung mit Heine durch geselliges Zusammensein während der kulinarischen Versorgungspause am Samstagnachmittag mit Kaffee und eigens von den Vereinsmitgliedern gebackenen Kuchen im Rosengarten.
Als letzter Programmpunkt am Samstag gab die Künstlergruppe Christian Georgie und Detlev Rose ein Konzert, das mit einer Mischung aus Liedern, Gedichten, Prosa und Briefauszügen Reminiszenzen an Heinrich Heine erweckte, und dadurch eine musikalische Begegnung mit dem Dichter für das Publikum ermöglichte. Die Menschen vor Ort waren derart angetan von der Gruppe, dass sie nicht nur zahlreich erschienen waren, sondern unter großen Beifall auch noch eine Zugabe für sie gespielt wurde.
Sonntag
Prof. Dr. Eckart Pastor und Uta von Beckerath: Zum Beispiel ,,süß“: Vom ,,süßen Frätzchen“ und ,,süßen Schmätzchen“ zu ,,dunkelsüßem Grausen“ und ,,süßnärrischen Lauten“. Wie Heinrich Heine sich die Potentialitäten eines Wortes erschließt
Unter der Lesebegleitung von Uta von Beckerath vervollständigte Prof. Dr. Eckart Pastor die vielfältige Vortragsreihe der diesjährigen Stormtage. Auf der Textgrundlage von Heinrich Heines Gedichten (aus „Buch der Lieder“ und „Romanzero“), Dramen, Reiseberichten sowie literarischen Charakterportraits untersuchte Prof. Dr. Pastor die „verschlungenen Wege in Heines Dichtung und Fülle an Bedeutungsvielfalt“ am Beispiel der verschiedenen Semantiken von „süß“. Dahingehend knüpfte er an den von Gerhard Höhn in der Heine-Forschung geprägten Begriff der „kontraästhetischen Schreibweise“ an. Die Semantiken von „süß“ ordnete Prof. Dr. Pastor in vier verschiedene Kategorien ein: (1) Komische Kontraste, (2) Abtönungen (berückende Bedeutungsschwebe), (3) komisch-ernste Streiche und (4) süß-närrische Laute.
Stadtspaziergang durch Heiligenstadt auf Heines Spuren
Aufgeteilt in zwei Gruppen stellten die Stadtrundführenden Sigrid Seifert und Günter Liebergesell auf einem Spaziergang durch Heilbad Heiligenstadt verschiedene Stationen vor, an denen Heinrich Heine für seine Taufe am 28.06.1825 vorbeigekommen war oder an denen heute noch an Heinrich Heine erinnert wird (z. B. im Heinrich-Heine-Kurpark). Auch das Leben der jüdischen Gemeinde in Heiligenstadt wurde näher beleuchtet. Dahingehend vermittelte Frau Seifert passende Eindrücke beim Standort der ehemaligen Synagoge der Stadt in der Stubenstraße (Nr. 14). Nach der Rückkehr zum Literaturmuseum klang der frühe Nachmittag schließlich bei der Einnahme eines gemeinsamen Imbisses aus.
Die zweite besondere Schenkung von dem Storm-Nachfahren Detlev Krey
Zu unserer großen Freude befanden sich unter unseren Gästen auch dieses Jahr Nachfahren und Nachfahrinnen von Theodor Storm. Mit besonderer Wertschätzung dankte der Museumsleiter Dr. Haut stellvertretend für Museum und Storm-Verein dem Storm-Nachfahren Detlev Krey für eine weitere großzügige Schenkung anlässlich der diesjährigen Stormtage. Das betreffende Konvolut besteht aus Briefen, einem Kartoffeltheaterstück und einer Brosche mit eingewobenem Echthaar aus der mütterlichen Linie der Familie Storm.
Ab sofort können Sie neben der Echthaar-Brosche auch zwei andere, zuvor getätigte Schenkungen von Herrn Krey bei uns in der Dauerausstellung bestaunen!
Anerkennender Dank gilt allen Referierenden bzw. Vortragenden, allen Menschen, die uns während der Stormtage besucht haben, sowie natürlich allen Mitgliedern des Storm-Vereins, die mit ihrem Engagement die diesjährigen Stormtage erst ermöglichten.