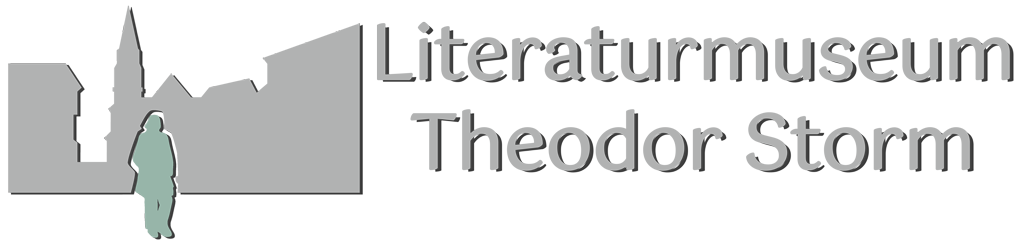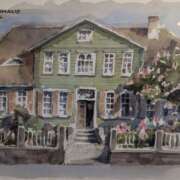Der dichtende Gärtner und sein singendes-klingendes Notizheft (1/2)
Am heutigen Abend auf den Tag genau vor 169 Jahren traf Theodor Storm zusammen mit seinem Vater Johann Casimir in Heiligenstadt ein. Diese Ankunft sollte den über 7 Jahre andauernden Lebensabschnitt begründen, den er mit seiner Ehefrau Constanze und seiner zuletzt auf sechs Kinder angewachsenen Familie hier verbrachte. Dieser Tag könnte auch der direkte Auslöser für die Übersiedlung eines weiteren Storm-Sohnes nach Heiligenstadt gewesen sein. Gemeint ist hierbei Theodors zweitjüngerer Bruder Otto Storm.
Der folgende zweiteilige Blogbeitrag verfolgt das Ziel, sich ein Bild über Otto Storm, sein Leben sowie seinen Charakter, zu verschaffen. Dahingehend werden Erkenntnisse, die aufgrund akribischer Transkriptionsarbeit von ehrenamtlichen Helferinnen an einem Notizheft aus Otto Storms Privatbesitz getätigt werden können, in den bisherigen Forschungsstand eingeordnet und ausgewertet. Ergänzend dazu wird das Notizheft, dessen Aufbau, Inhalt, Überlieferungszustand und die Schwierigkeiten bei der Übertragung der Kurrent-Handschrift in lateinischer Druckschrift vorgestellt. Besonders das Interesse von Theodor Storms „Bruder Gärtner“ an der Schöpfung eigener Dichtkunst kann an beispielhaften Erzeugnissen beleuchtet werden, die uns nun anhand des Notizhefts hinterlassen worden sind.
Was wissen wir über Otto Storm?
Nach dem Kauf eines Grundstücks vor dem Kasseler Tor betrieb Otto Storm dort selbstständig eine Handels- und Kunstgärtnerei. In dem sich darauf befindlichen großen Wohnhaus an der Landstraße mietete sich Theodor Storm zunächst mit Kind und Kegel ein. Demgegenüber bewohnte Otto als Grundbesitzer und Vermieter seines Bruders das kleinere Haus unten im Garten. Ähnlich zu Theodor unterstützte der Vater auch Otto finanziell, sodass diesem möglich gewesen war, jenes umfangreiche Grundstück zu erwerben.
Wahrscheinlich ist, dass Johann Casimir bereits am 19.08.1856 bei seinem gemeinsamen Besuch mit Theodor in Heiligenstadt von der Garnspinnerei hörte, die jenes geräumige Grundstück zuvor ausgefüllt hatte, aber bald darauf ihren Betrieb hatte einstellen müssen. Dem Vater wird vielleicht auch am selben Tag die Idee gekommen sein, Otto das Geld zum Kauf des so vakant gewordenen Grundstücks zur Verfügung zu stellen. Schließlich beendete die Entscheidung, das Grundstück zu kaufen, die einjährige, unter anderem in Erfurt und Schleswig-Holstein angestellte Suche nach einem solch passenden für eine eigene Gärtnerei. Bereits ein halbes Jahr später wechselte Theodor samt Familie jedoch zu einem anderen Mietverhältnis in eine zwei Etagen umfassende Wohnung in der Wilhelmsstraße gelegen (Nr. 73) über.
Anders als der Schriftsteller sollte der Gärtner Storm bis zu seinem Lebensende 1908 mit seiner Familie dauerhaft hier wohnen bleiben.
Über Otto Storms Leben vor seinem Gärtnereibetrieb in Heiligenstadt herrschen nach wie vor einige Wissenslücken vor. Über seine Kindheit und Jugendzeit in Husum ist nicht viel bekannt. Allerdings wissen wir, dass er als sog. „freiwilliger Jäger“ in den militärisch ausgefochtenen politischen Unruhen von 1848/1849 involviert war. Mehr noch als sein ältester Bruder Theodor hatte sich Otto nicht nur mit Wort-, sondern auch mit Waffengewalt gegen Dänemark für die politische Unabhängigkeit Schleswig-Holsteins eingesetzt. Das war in mehrfacher Hinsicht nicht spurlos an ihm vorübergegangen.
Seine vorherige Tätigkeit als Zollbeamter konnte er in Schleswig-Holstein nach dem Sieg der dänischen Truppen in der Schlacht von Idstedt (1850) und der darauffolgenden 14-jährigen Besatzungszeit nicht mehr ausüben. Somit sah er sich, ähnlich wie Theodor Storm, dazu veranlasst, nach Preußen zu gehen. In Berlin hatte er wohl noch bis 1851 darauf gehofft, eine Ausbildung als Steuerbeamter zu absolvieren, um danach nach Husum zurückkehren zu können. Letztlich hatte er diesen Plan aber nicht bis zum Ende verfolgt.
Stattdessen fasste er den Wunsch fortan als Gärtner zu arbeiten. Im Auftrag Johann Casimirs holte Theodor für Otto 1852 in Berlin breitere Informationen über Kunstgärtnereien ein. Diese Bemühungen trugen ein Jahr später Früchte, denn Ende des Jahres 1853 fing Otto Storm seine Ausbildung in Berlin an. Bevor er Ende März 1855 nach Erfurt aufbrach, um dort als Gärtner „zu volontieren“, arbeitete er in den Königlich preußischen Gärten. Zuvor hatte sich Theodor um den Kontakt zu deren Generaldirektor bemüht, um eine dortige Anstellung für seinen Bruder zu erbitten.
Vor allem in den gemeinsamen Lebensjahren in Berlin hatte sich ein eng-familiäres Band zwischen „Bruder Dichter“ und „Bruder Gärtner“ geknüpft. Der damals noch als Junggeselle lebende Otto wurde von Theodor und Constanze als herzlicher Onkel beschrieben, der oft den Kontakt zu ihnen gesucht habe. Liebevoll habe er sich um seine Neffen und seine Nichte gekümmert. Im Gegensatz dazu entpuppte sich ihre Beziehung in der gemeinsamen Heiligenstädter Zeit als emotional unbeständig.
Otto Storms Notizheft: Deutsche Kurrent-Handschrift und deren Übertragungstücken
Seit einiger Zeit befindet sich im Sammlungsbestand des Literaturmuseums ein Notizheft in Kurrent-Handschrift von Otto Storm.
Dank der Sorgfalt und dem Fleiß von engagierten Helferinnen, die ehrenamtlich die Übertragungsarbeit leisteten, liegt es nun zugänglich in lateinischer Druckschrift vor. In mehrfacher Hinsicht ist dies ein beachtlicher Verdienst, dem großer Dank gebührt!
Trotz zunehmender Handschrift- und Rechtschreibstandardisierung durch die im 19. Jahrhundert allmählich flächendeckend durchgesetzte Schulpflicht ist die deutsche Kurrent-Schrift eine nicht leicht zu dechiffrierende Handschrift. Das ist vor allem darin begründet, dass das Schriftbild vorgibt, dass alle Wörter am besten je in einem rechtsschrägen Schwung durchgeschrieben werden. Das Schreibwerkzeug soll so wenig wie möglich abgesetzt werden. Zur einfacheren Verbindung der Buchstaben dienen die schrifttypischen Schleifen an deren Oberlängen. So erklärt sich auch der ihr gegebene Name „Kurrent“ (von lateinisch „currere“, zu Deutsch „laufen“).
Allerdings führt diese Eigenart dazu, dass bestimmte Buchstabenkombinationen beim Lesen schwierig wieder in einzelne Buchstaben zu zerlegen sind. Betroffen sind beispielsweise „m“ und „n“. Noch verzwickter gestaltet es sich, wenn nicht nur die Eigentümlichkeit der Schrift selbst, sondern die des jeweiligen Schreibenden beträchtlich das individuelle Schriftbild beeinflusst. Oft vorkommende Erschwernisse sind unvorhergesehene, nicht standardisierte Buchstabenvariationen zu lateinischer Schrift oder Mischungen zwischen dieser und Kurrent, sodass derselbe Buchstabe in unterschiedlicher Art in demselben Text realisiert sein kann. Aber auch Rechtschreibfehler oder fehlende Kennzeichnungen zur Abhebung einzelner Buchstaben gegenüber anderer können problematisch sein. So ist ohne den geschwungenen Bogen über dem „u“ ein Unterschied zu „n“ per se nicht mehr erkennbar. Zudem kann ein ausladend geschriebenes „e“ in deutscher Kurrent-Schrift ebenfalls deckungsgleich zu „n“ oder „u“ (ohne geschwungenen Bogen) sein.
Auch im Hinblick auf Otto Storms Fall lassen sich die eben geschilderten Tücken im Entziffern einer Handschrift in Kurrent nicht leugnen. Ergänzend zu den bereits aufgezählten Beispielen, neigt Otto nicht nur dazu, einzelne Buchstaben und Wörter mit zusätzlichen Schnörkeln zu versehen, sondern auch seine Profession als Gärtner hinterließ bleibende Spuren in der formalen sowie inhaltlichen Gestaltung seiner in dem Heft überlieferten privaten Fachnotizen. Ab Ende des 18. Jahrhunderts wurde vor allem in West- und Mitteleuropa der englische Landschaftsgarten als Gegenprodukt zum französisch geprägten Barockgarten für den Gartenbau stilistisch wegweisend. Im Zuge dessen etablierte sich Englisch als Verkehrssprache unter Gärtnern und Gärtnerinnen. Dementsprechend überrascht es nicht, dass Otto Storm sogar einige Textpassagen gänzlich auf Englisch verfasste.
Eigentlich sollte dies bei vorhandenen Englischkenntnissen das Leseverständnis heutzutage erleichtern, weil sowohl einzelne Begriffe als auch komplette Sätze auf einer anderen Sprache als Deutsch üblicherweise in lateinischer Schreibschrift abgefasst wurden. Allerdings verwendete Otto weder Schrift noch Sprache in gängiger Weise, gar einheitlich. Manchmal schleichen sich Rechtschreibfehler in englische Wörter ein. So kommt ein chaotisches Gemengegelage zusammen: Mitten in deutschsprachigen Textteilen taucht ein oder gleich mehrere englische Wörter in deutscher Kurrent-Schrift verfasst auf, die zum Teil nicht korrekt wiedergegeben sind. Ergänzend dazu ist es wichtig zu erwähnen, dass das Notizheft zweigeteilt ist. Zudem reißt es immer wieder inhaltlich ab, entweder bewusst von Otto selbst so vorgenommen oder unvermutet aufgrund unvollständiger Überlieferung. Fehlende Inhalte sind (bisher) nicht bekannt und können anhand der erhaltenen Notizheft-Schriften nicht rekonstruiert werden.
Fortsetzung folgt im zweiten Blogbeitragsteil…