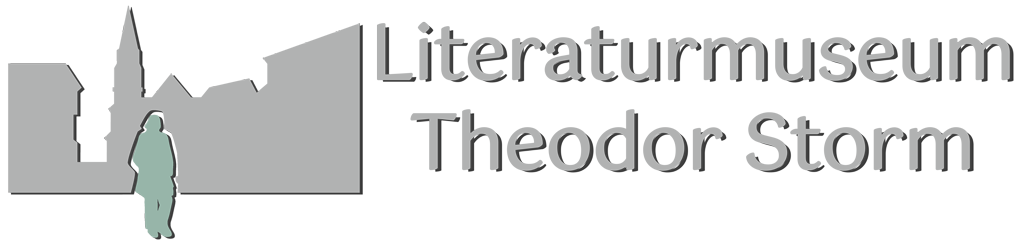Storm, wie hast du ’s mit der Politik?
Am 10. Mai 2021 jährt sich das offizielle Ende des Deutsch-Französischen Krieges von 1871 zum 150. Male.
Als Theodor Fontane 1871 seinen Dichterkollegen Theodor Storm um ein Loblied auf die siegreichen Preußen bat, lehnte Storm dieses Ansinnen rigoros ab: „Lieber Fontane, hol Sie der Teufel, wie kommen Sie dazu, dass ich eine Siegeshymne dichten soll!“
Die barsche Ablehnung geht einher mit früheren Äußerungen zum Thema Politik: Storm bezeichnete sich als einen „wenig politischen Menschen“. Er war überzeugt, Dichtung und Politik müssten getrennt betrachtet werden: „Wo Schwerter klirren, sind es nicht Gedichte“, schreibt er bereits 1843. Zwar bezog er in den Revolutionsjahren um 1848 Stellung für das Bürgertum, tat sich aber mit politischen Gedichten äußerst schwer. Sein Versuch, mit Naturlyrik politische Position zu beziehen, gefiel dem Publikum nicht – und ihm selbst noch weniger. Im Brief an seine Frau Constanze gibt er es offen zu: „Ein politisch Gedicht wollte ich machen, das mit Frühling beginnen sollte, aber ich konnte über diesen nicht hinaus.“
Storm liebte das Individuelle, das Nahe, das Sichtbare; bei ihm kommen die Menschen vor der Menschheit, er mochte Geschichten mehr als Geschichte. Politik war ihm erst wichtig, wenn sie sein direktes Umfeld betraf. Heimat war für Storm ein Flecken seiner nahen Umgebung, nicht ein von Landesgrenzen bestimmbares Territorium, dessen Umrisse sich 1871 abermals änderten. Falls Storm eine Gesinnung zugeschrieben werden soll, dann höchstens eine antiaristokratische, in erster Linie aber eine demokratische.
Zitate von Schriftstellern, noch dazu längst verstorbenen wie Theodor Storm, werden heute gern in den verschiedensten Zusammenhängen genutzt. In Reden, auf Grußkarten oder eben auch in der Politik. Der Schriftsteller selbst kann meist wenig gegen diese Vereinnahmung tun. Er hat sein Werk der Öffentlichkeit übergeben. Es ist zur Interpretation freigegeben. Eine solche jedoch muss sich an objektiven, also von der Literaturwissenschaft überprüfbaren Kriterien messen lassen. Lässt sich eine Aussage an Textstellen oder Briefzitaten belegen? Konnte es Storm damals schon wissen, oder ist das Gesagte durch den heutigen Diskurs geprägt? Solchen kritischen Nachfragen muss jede Auslegung standhalten.
Storm lässt sich nicht vereinnahmen, weder als Mensch noch als Dichter. Dafür war er zu komplex, zu facettenreich, zu einzigartig. Jeder Versuch, Storm heutzutage parteilinienkonform zu deuten, ist eine grobe Verzerrung, die banalisierend einzelne Motive – etwa das der Heimat – zusammenhanglos herausreist aus seinem Werk.
So war es auch für die Germanistik in der NS-Zeit aussichtslos, Storm für sich zu reklamieren. Das lässt sich bereits mit Storms Helden erklären: Sie haben meist tragische Existenzen, sie begehen Fehler, sie scheitern. Hauke Haien aus Storms „Schimmelreiter“ ist da nur das bekannteste Beispiel.
Storm richtet seinen diagnostischen Blick auf die Gesellschaft in all ihren Facetten und in all ihrer Vielfalt. Dabei war er besonders an der menschlichen Psychologie interessiert. Was treibt den Menschen an, was bedingt seine Entscheidungen? Nicht selten lag dabei sein Fokus auf den devianten, traumatisierten Charakteren, nicht auf unfehlbaren Heroen.
Storm prangert, etwa in der Novelle „Eine Malerarbeit“, die auf Heiligenstädter Erlebnissen beruht, Ausgrenzung und Stigmatisierung von Außenseitern auf schärfste an.
Storm verabscheute Unrecht und Gewalt. Er war sich zwar seines Einflusses als Dichter bewusst, sah seine Stärke aber nicht im Politischen, sondern versuchte stets, Überzeitliches, Menschliches einzufangen und zu veranschaulichen. Deshalb lesen wir ihn heute noch.