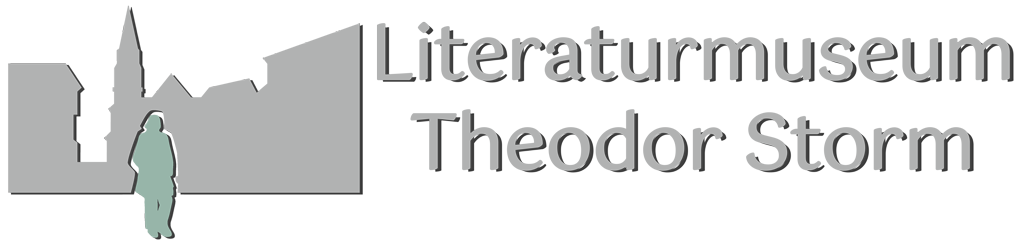Heine und Storm – zwei Nordsee-Dichter
Text von Jakob Malzahn, B. A. (Praktikant vom 16. September – 10. Oktober 2025)
Nicht nur Heiligenstadt spielt eine wichtige Rolle in der Biografie Theodor Storms und Heinrich Heines, sondern auch die Liebe zum Meer. Während Storm durch seine Heimat von Beginn an mit der Nordseeküste innig verbunden ist, lernt Heine die Nordsee vor allem während seiner Aufenthalte auf der Insel Norderney lieben.
1825: Heine macht Urlaub auf Norderney
Es sind ein paar Wochen seit seiner Taufe in Heiligenstadt vergangen, als Heine sich im August 1825 zum Urlaub auf Norderney einfindet. Frisch zum Doktor der Rechte promoviert – Note: „rite“ (genügend) – darf er sich mit freundlicher Unterstützung seines vermögenden Onkels Salomon von den Strapazen des unliebsamen Jura-Studiums erholen. Sein Vorhaben: „An gar nichts denken und bloß des Morgens den Kopf in die schäumenden Wogen der Nordsee sorglos hineinstecken.“ Während seines Urlaubs beginnt Heine mit dem dreiteiligen Text Die Nordsee. Ist der dritte Teil ein spöttischer Reisebericht über die Urlauber im Nordseeheilbad und die Insulaner, so avanciert Heine mit seinen an Oden angelehnten Gedichten in Teil eins und zwei nach seinen Worten zum „Hofdichter der Nordsee“.
1855: Storm hat Heimweh nach Husum
Wir spulen rund 30 Jahre vor: Theodor Storm befindet sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Potsdamer Exil und wird bald mit seiner Familie nach Heiligenstadt umziehen. Zwischen 1854 und 1855 entsteht sein berühmtes Gedicht Meeresstrand. Museumsbesucher finden es im ,Großformat‘ im ersten Ausstellungsraum vor. Es ist ein beeindruckender Gesang auf die von Storm so schmerzlich vermisste Nordsee:
Meeresstrand
Ans Haff nun fliegt die Möwe,
Und Dämmrung bricht herein;
Über die feuchten Watten
Spiegelt der Abendschein.
Graues Geflügel huschet
Neben dem Wasser her;
Wie Träume liegen die Inseln
Im Nebel auf dem Meer.
Ich höre des gärenden Schlammes
Geheimnisvollen Ton,
Einsames Vogelrufen –
So war es immer schon.
Noch einmal schauert leise
Und schweiget dann der Wind;
Vernehmlich werden die Stimmen,
Die über der Tiefe sind.
Heine als dichterisches Vorbild Storms
Seit seiner Jugend ist Heine eine Art Säulenheiliger Storms. In seinen Erinnerungen schildert Storm, wie er mit seinem Freund Ferdinand Röse als Jugendlicher eine ganze Nacht hindurch Heines Buch der Lieder rezitiert. Auch die Gedichte des Nordsee-Zyklus sind im Buch der Lieder enthalten. In Heines Natur- und Liebeslyrik sah Storm vollendete Beispiele von „Stimmungsgedichten“, die er selbst anstrebte.
Der Nordsee-Zyklus ist im Gegensatz zu Heines restlicher Lyrik in freirhythmischen Versen verfasst. „Unsere gewöhnlichen Süßwasserleser kann schon allein das ungewohnt-schauklende Metrum einigermaßen seekrank machen“, kommentierte Heine dies. Obwohl Storm beileibe kein Süßwasser-Mensch war, bleibt fraglich, inwiefern er diese unkonventionelle Lyrik Heines ästhetisch billigte. Trotz aller Bewunderung war Storms Beurteilung der Lyrik Heines durchaus ambivalent. Lässt man diese Bedenken einmal beiseite, stößt man dennoch auf ein Nordsee-Gedicht Heines, das starke Ähnlichkeiten zu Storms Meeresstrand aufweist. Es ist das Gedicht Abenddämmerung, das den Zyklus (in der Erstausgabe) eröffnet:
Abenddämmerung
Am blassen Meeresstrande
Saß ich gedankenbekümmert und einsam.
Die Sonne neigte sich tiefer und warf
Glührote Streifen auf das Wasser,
Und die weißen, weiten Wellen,
Von der Flut gedrängt,
Schäumten und rauschten näher und näher –
Ein seltsam Geräusch, ein Flüstern und Pfeifen,
Ein Lachen und Murmeln, Seufzen und Sausen,
Dazwischen ein wiegenliedheimliches Singen –
Mir war, als hört ich verschollne Sagen,
Uralte, liebliche Märchen,
Die ich einst, als Knabe,
Von Nachbarskindern vernahm,
Wenn wir am Sommerabend,
Auf den Treppensteinen der Haustür,
Zum stillen Erzählen niederkauerten,
Mit kleinen, horchenden Herzen
Und neugierklugen Augen; –
Während die großen Mädchen,
Neben duftenden Blumentöpfen,
Gegenüber am Fenster saßen,
Rosengesichter,
Lächelnd und mondbeglänzt.
Entfremdung oder Einfühlung?
Auf den ersten Blick unterscheidet sich dieses scheinbar formlose Gedicht Heines stark von Storms strophenförmigen Gedicht. Schaut man aber näher hin, entdeckt man erstaunliche Ähnlichkeiten. Zunächst ist die Grundsituation dieselbe: Ein einsames lyrisches Ich erlebt die Abendstimmung an der Nordsee. Die Begegnung mit dem Meer wird in beiden Gedichten als mystisch oder zumindest märchenhaft beschrieben. Die Meeresgeräusche nehmen eine Schlüsselfunktion ein. Bei Storm wird der Ton des „gärenden Schlammes“ erwähnt, „einsames Vogelrufen“ wird heraufbeschworen und ein schauernder Wind wird beschrieben. Zum Schluss dann die rätselhaften Verse: „Vernehmlich werden die Stimmen, / Die über der Tiefe sind.“ Besonders über die letzte Wendung haben Interpret:innen sich den Kopf zerbrochen. Handelt es sich hierbei um eine Hinwendung zum Innenleben des lyrischen Ichs? Oder gar um eine Kontaktaufnahme mit den Toten?
Bei Heine wiederum lösen die Meeresgeräusche eine Kindheitserinnerung aus. Obwohl diese Kindheitserinnerung in einem für Heine typischen, verspielten Ton, der die Motive der Romantik zitiert, präsentiert wird, äußern sich die Meeresgeräusche als „seltsam“ und unheimlich. Grundsätzlich lässt sich in Bezug auf beide Gedichte die Frage stellen, ob es sich wirklich um Nordsee-Gedichte handelt oder ob das Meer in den Gedichten lediglich eine Projektionsfläche bietet. In Bezug auf das Gedicht von Storm gehen manche Interpret:innen sogar so weit, darin die Darstellung einer Entfremdung zwischen Natur und Individuum zu erkennen.
In beiden Gedichten setzt sich das lyrische Ich zum Naturschauspiel in ein Verhältnis. Durch die Nähe zum Meer scheint es bei Storm Beruhigung zu erlangen („So war es immer schon“) und bei Heine wird das „gedankenbekümmert[e] und einsam[e]“ lyrische Ich durch die Meeresgeräusche an erfreuliche Kinderszenen erinnert, was vor allem durch die „neugierklugen Augen“ und „horchenden Herzen“ auf wunderbare Weise artikuliert wird. Freilich geht die Spiegelung der eigenen Empfindungen hier so weit, dass das Gedicht in einer merkwürdigen Kindheits-Vision endet. Bei Storm verbleibt das lyrische Ich beim Natureindruck.
Klangkunstwerke
Der Klang des Meeres wird in den Gedichten nicht nur erwähnt, sondern auch hörbar gemacht. Durch lautes Vorlesen lässt sich nachvollziehen, auf welche Weise es Storm gelingt, akustisch Stimmung zu evozieren. So vollführt der begabte Musiker Storm das Kunststück, dass sich die Spiegelung des Abendscheins auf dem Watt durch eine metrische (rhythmische) Spiegelung der Verszeilen drei und vier mit den Verszeilen fünf und sechs untermalt wird: Die jeweiligen Verspaare haben ein identisches Metrum. Die düstere Abendstimmung wird klanglich untermalt durch die dunklen Vokale in der dritten Strophe: „Ton“, „rufen“, „schon“. Heines scheinbar locker hingeworfene Verse erweisen sich beim Rezitieren ebenfalls als ein sorgfältig durchkomponiertes Klangkunstwerk. Auch hier wird der Abendschein gespiegelt; Alliterationen am Versende verdeutlichen dies: „warf“, „Wasser“, „Wellen“. Der darauffolgende gedrängte Vers veranschaulicht die „gedrängte Flut“. Dann schwellen die Meeresgeräusche an – analog dazu werden die Verse länger.
Werden Sie selbst kreativ!
Heine und Storm, diese beiden bedeutenden Lyriker des 19. Jahrhunderts, haben sich auf je eigene Weise mit der Nordseeküste als Landschaft und Kulturraum auseinandergesetzt. In unserem Lyrik-Zimmer im Erdgeschoss können sie auf Grundlage eines Storm- und eines Heine-Gedichts selbst kreativ werden. Wir haben für die einzelnen Wörter Bausteine erstellt, die an einer Tafel angeordnet werden können. Ergänzend stehen Bausteine mit Begriffen aus dem unerschöpflichen Fundus der Jugendwörter zur Verfügung. Zudem können sie in diesem Zimmer mehr über die Lyrik Storms und Heines erfahren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!