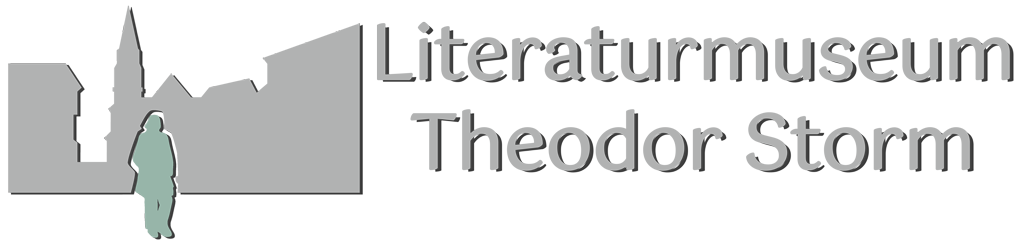Der kleine Häwelmann – Ein Kindermärchen als allegorischer Kommentar zur zeitgenössischen Politik
Kommendes Wochenende stehen wieder unsere alljährlichen Stormtage an. Der thematische Schwerpunkt liegt auf Heinrich Heines evangelisch-lutherischer Taufe in Heiligenstadt, die sich 2025 zum 200. Mal jährt. Im selben Zug wird der offizielle Verkaufsstart des neuesten Jahrgangs unserer jährlichen Wissenschaftspublikation der Storm-Blätter eingeläutet. Dieses Mal handelt es sich um eine ganz besondere Sonderausgabe zu Theodor Storms Kindermärchen „Der kleine Häwelmann“!
Um auf diese besondere Veröffentlichung einzustimmen und beispielhaft zu zeigen, wie komplex dieses kurz abgefasste Werk ist, soll im Folgenden eine von vielen interessanten Lesarten des Textes vorgestellt werden: „Der kleine Häwelmann“ als allegorisch gestalteter Kommentar zur zeitgenössischen politischen Situation in Schleswig-Holstein.
Als eines der bekanntesten Werke Theodor Storms und als gar zeitlos anmutende Gute-Nacht-Geschichte für Kinder gilt heutzutage „Der kleine Häwelmann“. Anlässlich der Geburt seines ersten Sohnes Hans, am 25.12.1848, verfasste er den Text und stellte ihn seiner eigenen Datierung zufolge in Husum 1849 fertig. Veröffentlicht wurde das von Theodor Storm persönlich ausgewiesene Kindermärchen im Volksbuch auf das Jahr 1850 für Schleswig, Holstein und Lauenburg. Bereits anhand der Jahreszahl lässt sich erkennen, dass seine Ersterscheinung in die Zeit großer gesellschaftlicher und politischer Umbrüche fiel. Die aus der sogenannten Schleswig-Holstein-Frage resultierte Erhebung gegen Dänemark sollte die Zukunft aller deutschsprachigen Territorien hinsichtlich ihrer nationalen Identität und Zugehörigkeit nachhaltig beeinflussen.
Bis 1459 hatte die Linie Holstein-Rendsburg aus dem Adelsgeschlecht der Schauenburger die Herzöge von Schleswig sowie die Grafen von Holstein gestellt. Nach dem Tod Adolfs VIII. war dieser Teil der Familie erloschen, weil er keine Kinder, vor allem aber keinen männlichen Erben hinterlassen hatte. Anders als die Grafschaft Holstein war das Herzogtum Schleswig kein römisch-deutsches Reichslehen, sondern unterstand als Lehen der dänischen Krone. Darüber hinaus war der damals amtierende dänische König, Christian I. der Neffe Adolfs (der Sohn seiner Schwester Heilwig von Holstein) gewesen. Nach dänischem Erbrecht und in seiner Funktion als Grundherr hatte Christian durchaus über eine berechtigte Verfügungsgewalt für das Herzogtum Schleswig geboten. Demgegenüber hatte die übriggebliebene Schauenburg-Linie Holstein-Pinneberg nach salischen Erbrecht einen stärker begründbaren und somit rechtmäßigeren Herrschaftsanspruch auf die Grafschaft von Holstein besessen. Sie hatte mit dem dänischen König um die Herrschaft über Holstein konkurriert, aber sich nicht gegen Christian durchsetzen können.
Letztlich hatte die Schleswig-Holsteinische Ritterschaft den dänischen König 1460 zum Herzog von Schleswig und Grafen von Holstein gewählt, womit die Personalunion zwischen Dänemark und Schleswig-Holstein im Vertrag von Ripen beschlossen worden war. Das wichtigste Privileg im Vertrag von Ripen war, dass Schleswig-Holstein nun nach dem Einheitsverständnis gemeinsamer Landesherrschaft auf ewig ungeteilt („up-ewig-ungedeelt“) bleiben sollte. Juristisch betrachtet war die Gültigkeit des Vertrags von Ripen an Christian I. als Vertragsnehmer gebunden, womit die Ripener Privilegien bereits nach dem Tod des Monarchen hinfällig geworden waren. Allerdings wurde der damit verbundene Grundgedanke des (internen) Fehdeendes des Adels um die territoriale Herrschaft über beide Gebiete weitergegeben. Somit blieben die dänischen Könige die Landesherren von Schleswig-Holstein, wobei die schleswig-holsteinische Ritterschaft ihre Sonderstellung diesen gegenüber behielt.
Das lange 19. Jahrhundert wird mentalitätsgeschichtlich in Europa als Erfindungszeit der modernen Nationalitätsidee als zukünftig maßgebliche Projektionsfläche menschlicher Identität bewertet. Aus ihr entstanden der Gründungswille zu „eigenen“ modernen Nationalstaatengebilden, genauso wie der national-völkische (bald auch rassische) Abgrenzungsgedanke zu anderen Ethnien und Nationalstaaten. Auch Schleswig-Holstein als multiethnisches Gebiet geriet zunehmend bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts in das Spannungsfeld von dänisch- sowie deutsch-nationalen Identitäts- und Zugehörigkeitskonflikten. Befeuert durch den anschwellenden Widerstreit im Herzogtum Schleswig zwischen dänisch-nationalliberalen und deutsch-nationalliberalen Bewegungen, der in der Märzrevolution 1848 seinen Höhepunkt fand, brach ein dreijähriger Krieg (auf deutscher Seite auch „Schleswig-Holsteinische Erhebung“ genannt) aus. In diesem kämpfte die dänische Armee von König Friedrich VII. gegen die Truppen der schleswig-holsteinischen Separatisten, um Schleswig-Holstein dem zukünftigen dänischen Nationalstaat einzugliedern.
Theodor Storm positionierte sich aus politischer Überzeugung und aufgrund eigenen schleswig-deutschen Identitätsempfindens auf der Seite der schleswig-holsteinischen Separatisten und damit gegen eine nationale Zugehörigkeit Schleswig-Holsteins zu Dänemark. Seine Meinung zeigte er mehrmals offen. So trat er dem sogenannten „Patriotischen Hülfsverein“ bei, publizierte politische Stellungsnahmen in der „Schleswig-Holsteinische Zeitung“ und unterzeichnete 1849 wie sein Vater Johann Casimir eine Petition gegen den Herrschaftsanspruch des dänischen Königs als Landes- bzw. Grundherr über das Herzogtum Schleswig.
Auch zu Beginn der 14-jährigen dänischen Besatzungszeit nach der verlorenen Schlacht von Idstedt (1850) engagierte sich Storm in seiner Funktion als Rechtsanwalt für die Husumer Bevölkerung, die sich nun der Unterdrückung der dänischen Behörden ausgesetzt sah. Ohne Folgen blieb das alles für Storm nicht. Nachdem die Bestätigung für seine Zulassung als Rechtsanwalt abgelehnt worden war, wurde ihm die Grundlage entzogen, seinen Beruf weiterhin selbstständig ausüben zu dürfen. Für den jungen Familienvater schloss das erhebliche Einbußen mit ein, die eine berufliche sowie finanzielle Abhängigkeitslage zu seinem Vater unumgänglich machten. Letztlich fühlte er sich gezwungen Husum mit Kind und Kegel zu verlassen, um in Potsdam wieder einer juristischen Erwerbstätigkeit nachgehen zu können.
In der Zeit während der Schleswig-Holsteinischen Erhebung und kurz vor der verheerenden Niederlage in der Schlacht von Idstedt, die lange danach noch die verlustreichste Schlacht Nordeuropas bleiben sollte, schrieb Theodor „Der kleine Häwelmann“. Er veröffentlichte es in seiner Erstfassung 1850 mit der Zusatzbeschreibung „Weil’s doch jetzt Zeit ist Märchen zu erzählen“. Somit bezog er den Textinhalt nicht nur auf die Handlung des Märchens, sondern auch mit einem bissig-ironischen Unterton auf das politische Zeitgeschehen.
Denn anders als im literarischen Zeitgeist der Romantik war das Märchen im Biedermeier zur trivial-anmutenden Kinderlektüre herabgestuft worden. Zwar wurde es im Gegensatz zum Literaturverständnis der aufklärerischen Dialektik akzeptiert, aber es sollte einen dezidiert herausgestellten Belehrungsinhalt haben, damit es den vorlesenden Eltern als Erziehungsmittel dienen konnte. Unter diesem Belehrungszweck bis dahin nicht angepasste Märchen wurden nur noch spärlich gelesen. Die Gattung war gesellschaftlich nicht mehr gefragt. Schon gar nicht erschien sie derart intellektuell ernstzunehmend zu sein, dass sie eine Lesart zur Kommentierung politischen Zeitgeschehens enthalten könnte.
In „Der kleine Häwelmann“ wird das Ikarus-Motiv evoziert. Als Himmelsstürmer wird der Häwelmann von der Sonne aus dem Himmel vertrieben und fällt ins Meer, in dem er fast ertrinkt. In Verbindung mit der verborgenen Tugendlehre des Mondes („Alles mit Maaßen!“) eröffnet diese Motivverwendung anhand dieser auf die zeitgenössische Politik bezugnehmende Beschreibung eine weitere Dimension an Interpretationsmöglichkeiten: Als Allegorie von starker Selbstüberhöhung und letztlichem Scheitern von unrechtmäßigen Eroberungsansprüchen wird der dänischen Monarchie nicht nur Hochmut und Willkür zugeschrieben, sondern ihr auch das unvermeidliche Misslingen der Annektierung von Schleswig-Holstein vorausgesagt.
Aufgrund seiner Gestaltung und Gattungszuweisung als Kindermärchen fand „Der kleine Häwelmann“ in der Literaturwissenschaft lange kaum Beachtung. Erst in den letzten Jahren wird die wissenschaftliche Marginalisierung von „Trivialliteratur“ (vor allem Frauen-, Kinder- und Jugendliteratur) revidiert. Auch diesem interessanten Kindermärchen von Theodor Storm wird zunehmend versucht seiner Vielschichtigkeit durch Untersuchungen aus verschiedenen Perspektiven gerecht zu werden. Es ist erstaunlich, welche Zeichen- und Informationsdichte dieser Text trotz seiner Kürze als Basis für so viele Lesarten hergibt. Genauso ist es bemerkenswert, inwieweit es besonders in seiner Fassung als Bilderbuch viele Erwachsenen- und Kinderherzen seit seiner Erstveröffentlichung bis heute für sich gewinnen konnte.
Sind Sie daran interessiert, mehr über „Der kleine Häwelmann“, den Zeitkontext seiner Erstfassung und seine verschiedenen Bilderbuch-Versionen zu erfahren?
Dann schauen Sie doch in unsere ab kommenden Wochenende erhältlichen Storm-Blätter (26. Jahrgang 2025), eine textkritische Sonderausgabe des Kindermärchens, hinein.
Es lohnt sich!