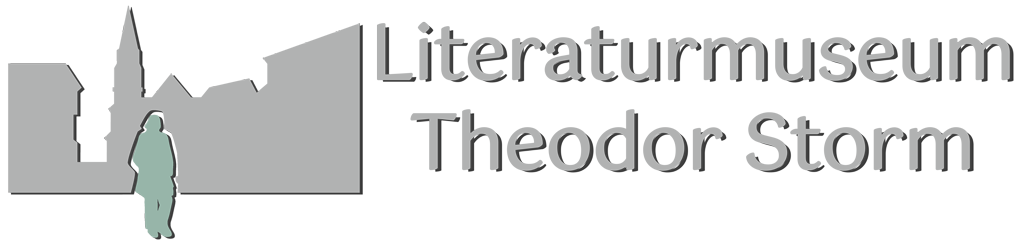Erbfluch? – Die spätere Beziehung von Theodor und Hans Storm
Text von Emily Kallmeyer (Praktikantin vom 21. Oktober – 05. Dezember 2025)
Obwohl Theodor Storm mit seinem liberalen Erziehungsstil seinen Kindern eine glücklichere Kindheit ermöglichen wollte als die eigene, kühlte das Verhältnis zu seinen Söhnen im Teenageralter zunehmend ab. Besonders sein ältester Sohn Hans wandelte sich für ihn vom Lieblingskind zum Sorgenkind.
Ludwig Pietsch, ein Freund Storms, beschreibt in seinem Buch „Wie ich Schriftsteller geworden bin“ die Erziehung der Söhne:
Die drei Jungen Hans, Ernst und Karl wurden vom Vater als seine Freunde und Kameraden behandelt, mit denen er selbst Dinge besprach und erörterte, welche man gemeinhin vor Knabenohren nicht zu berühren pflegt. Diese Art der Erziehung und der Behandlung der Kinder ist immer ein etwas gewagtes Experiment, wenn kein Unheil daraus erwächst, können Vater und Kinder von Glück sagen.
Storm selbst war von seinen Eltern eher kühl und distanziert erzogen worden. Er sehnte sich nach Liebe und Geborgenheit und wollte nicht wie sein Vater unfähig sein, Gefühle zu zeigen. Sein Vorsatz, es bei seinen Kindern besser zu machen, hielt jedoch dem Alltag nicht stand: Im Umgang mit Hans entwickelte er zunehmend jene Strenge, die er eigentlich vermeiden wollte. Aus dem Briefwechsel zwischen Lucie und Theodor Storm geht hervor, dass Hans sich bei den Großeltern in Husum gesundheitlich wie auch im Verhalten deutlich stabilisierte.
—
Nach dem Tod seiner Frau erwartete Storm, dass seine Söhne die familiären Lasten mittragen würden – auch indem sie sich seine Sorgen und Leiden bis ins Detail anhörten. 1866 schickte er Hans an die Universität Kiel, um Medizin zu studieren, obwohl dieser nach allgemeiner Einschätzung dafür kaum geeignet war. Während des Studiums verfiel Hans dem Alkohol und häufte Schulden an, die Storm immer wieder begleichen musste. Akademischen Ehrgeiz vermisste er bei allen Söhnen und machte ihnen dies regelmäßig zum Vorwurf. Gleichzeitig fürchtete er um den Ruf der Familie und insbesondere um die Heiratschancen seiner Töchter, die er durch Hans’ Trinkverhalten gefährdet sah. Auch das Asthma seines Sohnes bereitete ihm Sorgen – Hans’ seelische Gesundheit jedoch blieb für ihn weitgehend unbeachtet.
Das Bier ist in Bezug auf Euch Jungens eine von meinen Todesängsten. Soll ich Dir auch wieder ein Pfund Thee schicken? Das hilft, glaub ich, dagegen; denn Gott verhüthe, daß ich Dich „Bierdick“ nach Hause kommen sehe. […] Also, mein lieber Junge, schreib mir nun bald, wann Du mit dem Doctor fertig zu sein denkst. (Brief von Theodor Storm an Hans vom 26.03.1872)
1872 blieb Hans den Weihnachtsfeierlichkeiten in Husum fern – ein schwerer Schlag für den weihnachtsbegeisterten Vater. Zunächst drohte Storm, der Sohn solle sich ohne Doktortitel nicht mehr zu Hause zeigen; als ihm jedoch klar wurde, dass Hans diesen nicht erreichen würde, bat er ihn beinahe flehentlich, dennoch zu Weihnachten zu kommen. In seinen Briefen überhäufte Storm ihn zudem immer wieder mit melancholischen Gedanken und Erinnerungen an die verstorbene Mutter Constanze, mit der beide die meiste Zeit verbracht hatten. Der Briefwechsel wurde zunehmend von Vorwürfen, Kritik an Ausdruck, Rechtschreibung, Länge und Inhalt von Hans’ Schreiben sowie Storms wachsender Frustration geprägt. Die Stimmung verhärtete sich. Gelegentlich versuchte Storm zwar, seine Härte zu relativieren oder den Frieden wiederherzustellen:
Schreib nur wieder Deine harmlosen Briefe, und wenn es sein muß, auch ein wenig bummlich; das ist doch besser als der kalte Ton Deines letzten Briefes. (Brief von Theodor Storm an Hans vom 11.08.1871)
Doch der Schaden war längst angerichtet. Hans schrieb immer seltener, was Storms Sorgen, Wut und Einsamkeit verstärkte. Der Kreislauf aus Vorwürfen und halbherzigen Entschuldigungen überforderte Hans zunehmend. Verstärkt wurde die Entfremdung durch Storms Indiskretion: Er berichtete Freunden offen von Hans’ Scheitern und teilte sogar intime Gedichte, die er seinem Sohn schrieb. Obwohl er die Erziehung seiner Eltern kritisch sah, hoffte Storm selbst auf eine rege Briefkorrespondenz mit seinen Kindern – ein Wunsch, der in dieser Beziehung unerfüllt blieb.

Im Alter begann Storm, über die Erziehung und den Lebensweg seiner Söhne nachzudenken. Die Gründe für Hans’ Scheitern sah er zunehmend in ererbten Anlagen: Alkoholkranke Vorfahren hätten schlechte Eigenschaften weitergegeben. Hans sei, so Storm, „der unglückliche Erbe der Familienschuld“. Er sprach seinem Sohn jedoch nicht die Verantwortung ab, sondern warf ihm vor, dem vermeintlichen „Erbfluch“ nicht entgegengearbeitet zu haben, sondern sich ihm ergeben zu haben. Über seine eigene Mitverantwortung schrieb er:
Trifft mich dabei eine Schuld, so ist es nur die, daß ich die menschliche Natur überhaupt zu groß geschätzt habe. (Brief von Theodor Storm an Karl vom 28.03.1873)
Noch heute wird über das Verhältnis von „Anlage und Umwelt“ diskutiert: Wird ein Mensch überwiegend durch Gene oder durch äußere Einflüsse geformt? Dahinter steht auch die philosophische Frage nach dem freien Willen. Für Storm kollidierten diese Überlegungen mit seinem Humanitätsglauben und stürzten ihn in eine Sinnkrise, zumal er die christliche Vorstellung vererbter Schuld eigentlich überwunden hatte.
Auch als Hans später als Arzt praktizierte, blieb die Beziehung schlecht. Er konnte seinen problematischen Umgang mit Alkohol und Geld nie überwinden. Storms Plan, seine Tochter Lisbeth zu Hans zu schicken, um ihm einen geregelteren Alltag zu ermöglichen, scheiterte. Naiv hoffte er, Hans würde die Wirtshäuser meiden, wenn seine Schwester im Haus wäre; denselben moralischen Druck, den Bruder „retten“ zu sollen, übertrug er auch auf die Töchter Lucie und Elsabe. Auch dass Hans seine Briefe an den Vater zurückforderte und vernichtete, spricht für die Kälte zwischen ihnen. Am 5. Dezember 1886 starb Hans Storm in Aschaffenburg.
Ob aus Storms Erziehungsstil, wie Pietsch es andeutete, tatsächlich „Unheil“ erwuchs, oder ob Storm recht hatte, Hans’ Scheitern auf ererbte Anlagen zurückzuführen, lässt sich bis heute nicht eindeutig beantworten. Wahrscheinlich ist – wie die gegenwärtige Forschung nahelegt – ein Zusammenspiel aus beiden Faktoren. Gene eröffnen Möglichkeiten, die Umwelt entscheidet, wie sie genutzt werden. Gleichzeitig kann der Kontext genetische Tendenzen verstärken oder abschwächen. So könnte man fragen, ob Hans sich anders entwickelt hätte, wenn er ein eigenes Berufsziel verfolgt hätte, statt unter dem Druck zu stehen, Medizin zu studieren und den bürgerlichen Erwartungen seines Vaters zu entsprechen. Doch solche Überlegungen bleiben Spekulation.
Mein alter Junge, der Du eigentlich meine unglückliche Liebe bist. (Wortlaut aus einem Brief von Theodor Storm an Hans vor 1886)