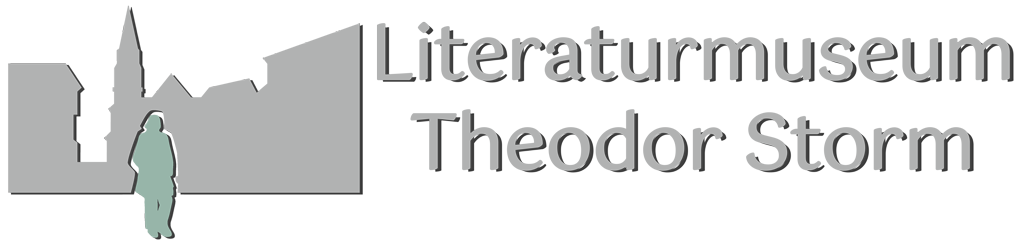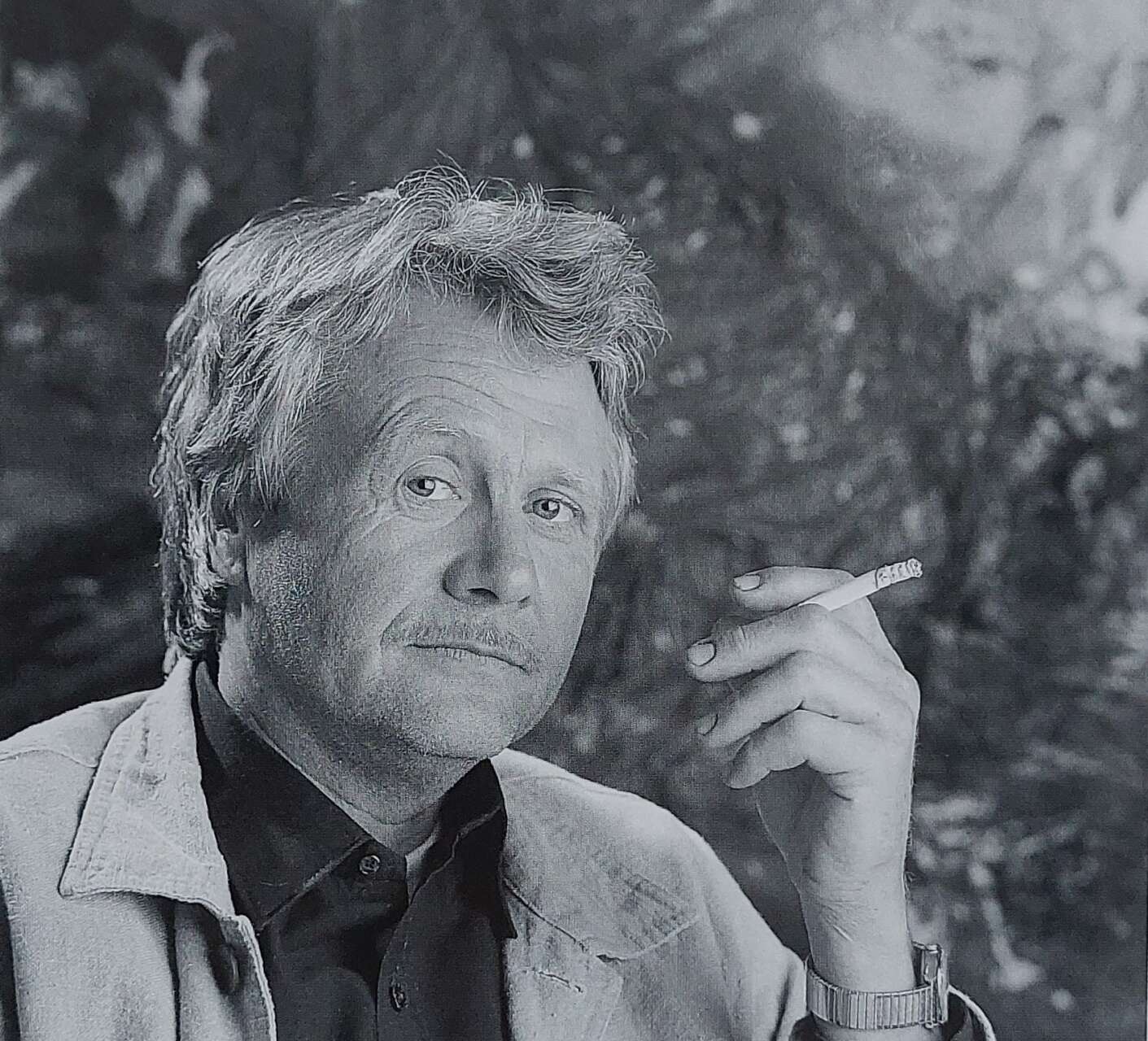Hauke Haien hat schon früh die Ambition, Deichgraf zu werden. Da er jedoch ohne Landbesitz nicht die Voraussetzungen dafür erfüllt, bleibt ihm sein Wunsch verwehrt. So muss er zunächst die Stelle des Kleinknecht beim Deichgrafen annehmen und entwickelt dort Gefühle für dessen Tochter Elke.
Elke tanzte an diesem Abend nicht mehr, und als beide dann nach Hause gingen, hatten sie sich Hand in Hand gefaßt; aus der Himmelshöhe funkelten die Sterne über der schweigenden Marsch; ein leichter Ostwind wehte und brachte strenge Kälte; die beiden aber gingen, ohne viel Tücher und Umhang, dahin, als sei es plötzlich Frühling geworden.
Als ihr Vater stirbt, kommt die Frage im Dorf auf, wer sein Nachfolger werden könnte, und so kommt Hauke ins Gespräch:
»Dort steht er«, sagte er, »die lange Friesengestalt mit den klugen grauen Augen neben der hageren Nase und den zwei Schädelwölbungen darüber!« […] »[W]as in den letzten Jahren Gutes für Deiche und Siele und dergleichen vom Deichgrafenamt in Vorschlag kam, das war von ihm; mit dem Alten war’s doch zuletzt nichts mehr.« […] »[U]nd Ihr meinet, er wäre nun auch der Mann, um in das Amt seines alten Herrn einzurücken?« »Der Mann wäre es schon, […] aber ihm fehlt das, was man hier ›Klei unter den Füßen‹ nennt; sein Vater hatte so um fünfzehn, er mag gut zwanzig Demat haben, aber damit ist bis jetzt hier niemand Deichgraf geworden.«
Daraufhin tritt Elke hinzu, die das Gespräch überhört hatte, und erzählt von ihrer Verlobung mit Hauke Haien, wodurch sein Landbesitz groß genug wäre, um Deichgraf zu werden.
»Das war schon vor geraumer Zeit; […] mein Vater war schon hinfällig worden, und da ich ihn kannte, so wollt ich ihn nicht mehr damit beunruhigen; itzt, da er bei Gott ist, wird er einsehen, daß sein Kind bei diesem Manne wohl geborgen ist. Ich hätte es auch das Trauerjahr hindurch schon ausgeschwiegen; jetzt aber, um Haukes und um des Kooges willen, hab ich reden müssen.« […] »Ja, liebe Jungfer«, sagte [der Oberdeichgraf] endlich, »aber wie steht es denn hier im Kooge mit den ehelichen Güterrechten?« […] »[I]ch werde vor der Hochzeit meinem Bräutigam die Güter übertragen. Ich habe auch meinen kleinen Stolz«, setzte sie lächelnd hinzu; »ich will den reichsten Mann im Dorfe heiraten!«
– Theodor Storm: Der Schimmelreiter