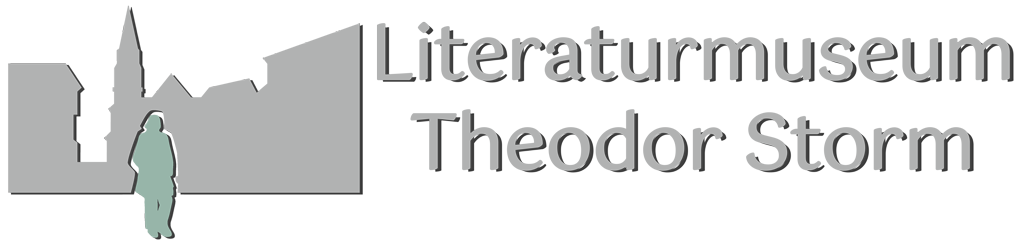Pole Poppenspäler – Sozialkritisches Plädoyer für die Kunst des Puppenspiels (2/2)
Inwieweit das Puppenspiel aus künstlerischer, sozialer und gesellschaftlicher Perspektive in Theodor Storm Novelle „Pole Poppenspäler“ kritisch reflektiert wird und welche Konsequenzen der mentalitätsgeschichtliche Wandel vom 18. bis ins 19. Jahrhundert für das Puppenspiel bis heute hat, erfahren Sie nun im zweiten Teil des literarischen Blogbeitrags März.
Die Darstellung der Puppenspiel-Familie anhand dreier Generationen der Tendlers in Storms Novelle verdeutlicht sowohl Veränderung als auch Bedeutung des Puppenspiels als eigene Kunstform sowie des damit einhergehenden Lebenswandels der Puppenspiel-Kunstschaffenden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eindrücklich.
Liseis Großvater mütterlicherseits ist in der Novelle als der „berühmte[] Puppenspieler Geißelbrecht“ benannt. Zwar werden wenige genaue Informationen über ihn gegeben, aber es lässt sich annehmen, dass er Mechanikus und Holz-Handwerker, vielleicht sogar speziell Drechsler gewesen sein muss. Denn er ist als Erschaffer der Figur des Kasperls im tendlerischen Puppeninventar ausgewiesen. Nicht nur entwarf er die mechanische Konstruktion von Kasperl, sondern setzte auch dessen figürliche Verarbeitung aus Holz um.*
Seine Tochter Therese Tendler – die Mutter von Lisei – ist überaus stolz auf ihren familiären Hintergrund. Auch Joseph Tendler spricht mit Hochachtung über seinen Schwiegervater. Es ist naheliegend, dass der Puppenspieler Geißelbrecht einer jener im ersten Beitragsteil beschriebenen Handwerksmeister war, der nach 1750 irgendwo in Süddeutschland ein oder mehrere lokal bzw. regional wandernde Puppentheater anleitete. Seine Handwerks- und Puppenspielkunst scheint zumindest lokal bzw. regional geschätzt worden zu sein. Geißelbrecht selbst war wohl ein angesehenes Mitglied innerhalb der Gesellschaft.
In seine Fußstapfen trat dann Joseph Tendler, der ebenso handwerklich tätig ist, allerdings ist er nicht als Mechanikus, sondern „nur“ als Holzschnitzer ausgebildet. Wahrscheinlich wird er als Geselle bei Herrn Geißelbrecht angestellt gewesen sein. Seine Schnitzarbeit für das Gesicht des Kasperls wird vordergründig als Prüfung zur Aufnahme in die Familie sowie Fortführung ihres Vermächtnisses beschrieben. Es liegt demnach nahe, sie auch als Meisterprüfung zu lesen.
Die Figur des Kasperls ist plastisch und damit auch symbolisch eng mit den beiden Prinzipalen des Puppentheaters (Meister Geißelbrecht und Joseph Tendler) verknüpft. Als Prinzipale werden die Leiter von Puppenspiel-Theatern bezeichnet. Auch Paul Paulsen baut eine seelisch-besondere Verbindung zu Kasperl auf, scheitert aber an dessen Reparatur und an dem Bau eines neuen Prinzipal-Kasperls. Seine aufwendigen puppenmechanischen Konstruktionen werden letztlich nur gedankliche Konstrukte aus seiner Kindheit bleiben. Das kommt den Ermahnungen seines Vaters entgegen, sich nur für eine befristete Zeit in der Kindheit mit Puppenspielen zu beschäftigen. Augenscheinlich ist die Identität eines ortsansässigen Handwerksmeisters als geachteter Bürger nicht mehr mit der eines Puppenspiel-Prinzipals zu vereinbaren. So wird für die Handlung vorausgedeutet, dass Paulsen das Erbe als Puppenspieler nach der Heirat mit Lisei nicht antreten wird.
Bereits im ersten familiären Generationswechsel von Großvater Geißelbrecht auf Vater Tendler deutet sich eine wichtige Veränderung an: Anders als zurzeit von Geißelbrecht scheint das tendlerische Puppentheater auf einen deutlich erweiterten Wanderradius angewiesen zu sein, der sogar bis nach Schleswig-Holstein reicht. Es genügte wohl aus finanziellen Gründen nicht mehr nur lokal oder regional in Süddeutschland Gastspiele abzuhalten (obwohl es zu der Zeit ein Kerngebiet des Puppenspiels war). Deswegen musste die Familie ihre Sesshaftigkeit aufgeben, um durch alle deutschsprachigen Gebiete reisen zu können.
Anhand von Paulsens Erzählung lässt sich über die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts hinweg erkennen, wie sich die öffentliche Wahrnehmung der Gesellschaft – vor allem aus dem breitgefächerten Milieu des Bürgertums – gegenüber der Puppenspiel-Familie zunehmend verschlechtert. Zwar werden die Tendlers bei ihrer ersten Ankunft in Husum schnell als Schaustellende ohne festen Wohnsitz erkannt, aber es wird ihnen noch nicht mit spürbarer Verachtung begegnet.
Zwölf Jahre später zeichnet sich eine andere Lebenssituation ab: In der mitteldeutschen Stadt muss Vater Tendler als Sündenbock für einen Diebstahl herhalten, den er nicht begangen hat, und der Schulze nimmt sowohl ihm als auch seiner Tochter die Pässe ab. Nur aufgrund der Gastfreundschaft von Paulsens Meisterin sind sie nicht gezwungen auf der Straße zu schlafen. Nicht nur Armut sondern auch Vorurteile und daraus resultierender Ausschluss aus der Gesellschaft sind deutlich erkennbare Folgen der von der Familie Tendler fortgeführten Tätigkeit in der Puppenspielkunst.
Zurück in Husum angekommen finden die gesellschaftlichen Anfeindungen voll an öffentlich ausgetragener Häme ihren Höhepunkt: Wegen der Eheschließung mit Lisei wird Paulsen mit dem Spottnamen „Pole Poppenspäler“ belegt. Das Ehepaar ist ständig verurteilenden Blicken oder böswilligem Gerede ausgesetzt. Vor allem Vater Tendler wird als verworrener Vagabund gebrandmarkt und mehrmals bloßgestellt. Seine Puppen werden mit Pflastersteinen attackiert, umhergeschleudert, verhöhnt und anderweitig drangsaliert. Auch wegen der gesellschaftlichen Verrohung – ein Resultat der napoleonischen Kriege – haben sich die Zeiten und damit auch ihr Publikum verändert. Paulsen nennt explizit den Kosakenwinter als Faktor für die gewalttätige Anstandslosigkeit, die Vater Tendler entgegengebracht wird.
Die Puppenspiel-Familie Geißelbrecht/ Tendler sowie ihr einstiges Renommee in der Puppenspiel- und Puppenhandwerkskunst erscheinen nun als Relikt einer bereits fern wirkenden Vergangenheit. Puppenspiel kann im voranschreitenden 19. Jahrhundert nicht mehr mit Stolz und aus künstlerischem Ausdruckswillen, sondern nur noch aus finanzieller Not heraus ausgeübt werden.
In der Novelle werden diese sozialen und gesellschaftlichen Missstände sichtbar gemacht und kritisiert. Sowohl das kindlich-gute Künstlerherz von Joseph Tendler als auch die künstlerische Eigenwertigkeit der Puppenspiel- und Puppenhandwerkskunst werden herausgestellt. Besonders Paul Paulsen kann aufgrund seiner kreativen Begabung und seiner kindlichen Offenherzigkeit die Traumwelten, die das Puppenspiel in der menschlichen Fantasie eröffnet, wertschätzen. Er gilt den Lesenden als moralische Instanz im Text, die beispielhaft durch ihr hohes Gerechtigkeitsempfinden Mitgefühl und Unvoreingenommenheit demonstriert.
Ähnlich zu Großvater Geißelbrecht lebt Paulsen als ortsansässiger Mechanikus- und Kunstdrechsler. Allerdings wird ihm trotz seinem Interesse und augenscheinlichen Talent für die Puppenspielkunst die Weiterführung des tendlerischen Puppentheaters zusammen mit Lisei von seinem eigenen Vater und nicht zuletzt von der Gesellschaft selbst verwehrt.
Es deutet sich ein Vorausblick auf die Zukunft des Puppenspiels bis in unsere heutige Gegenwart an, dessen künstlerischer Eigenwert zumindest in der und für die Kindheit erhalten werden kann. Sein eigentlich sehr komplexes Gesamterscheinungsbild der Komik kann nur noch in simplerer Ausdrucksform in der Unterhaltungs- und Lachkultur für eine junge Altersgruppe weiterexistieren. Seine wesentliche „lustige Figur“, der Kasper, ist seinem heutigen Publikum angepasst – er ist zum Kind für Kinder uminterpretiert worden.
Vergleichbar zur Komik im Puppenspiel hat die Novelle an einigen Stellen einen doppelten Boden mit einem interessanten, aber auch ziemlich komplexen symbolischen Gefüge. Deswegen lohnt es sich unbedingt, sie sich aus ganz unterschiedlichen Blickrichtungen heraus genauer anzuschauen und selbst einmal gelesen zu haben.
*Die Figur „Geißelbrecht“ in Storms Novelle basiert auf Johann Georg Geißelbrecht (1762-1826), der erfolgreichste Puppenspieler und Mechanikus zu seinen Lebzeiten.
Wahrscheinlich stieß Storm bei Recherchen durch die „Husumer Wochenblätter“ auf seinen Namen. Im selben Jahr als Storm geboren wurde (1817), gastierte Geißelbrecht mit seiner Truppe in Husum und führte als Teil des Spielplans auch seine Version von „Doctor Faust, eine Zauberkomödie in 5 Aufzügen“ auf. Vergleichbar zur realen historischen Person Geißelbrecht wird der letzte Verbleib der literarischen Figur in Süddeutschland (Weinheim) verortet. Abgesehen davon ist die Darstellung der Familie Geißelbrecht/ Tendler fiktionalisiert. Bei der Wiedergabe des Marionettentheaters zum „Doctor Faust“ innerhalb der Novelle wird im Übrigen Karl Simrocks Adaption (uraufgeführt 1846) herangezogen und nicht die Johann Georg Geißelbrechts. Nach der Vorstellung des Stücks scheltet Therese Tendler ihren Ehemann dafür, dass ihr Vater Geißelbrecht vor allem in seinen letzten Lebensjahren dieses Stück habe nicht mehr spielen wollen:
„[W]arum hab ich’s gelitten, daß du das gotteslästerlich Stück heute wieder aufgeführt hast! Mein Vater selig hat’s nimmer wollen in seinen letzten Jahren!“